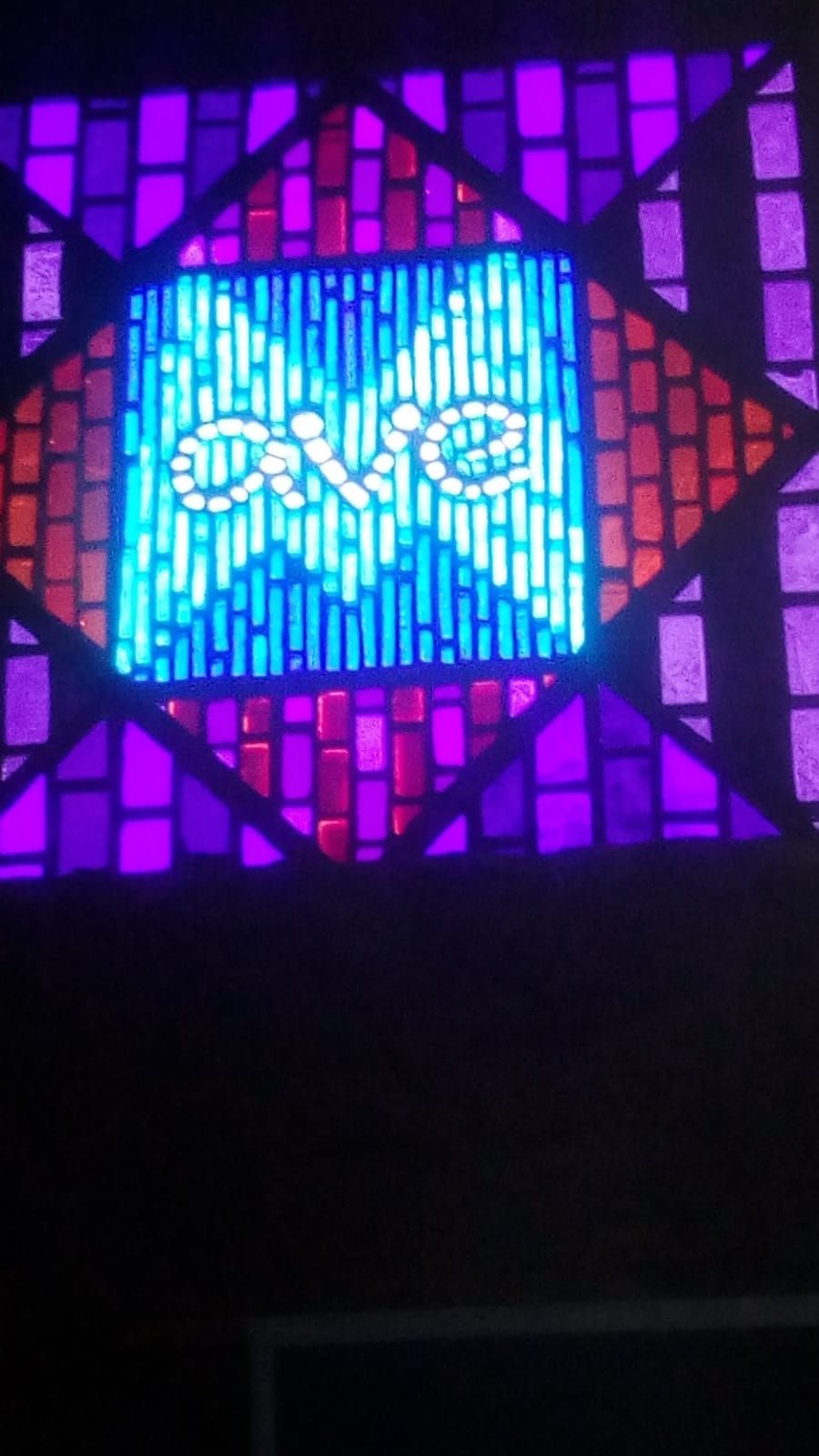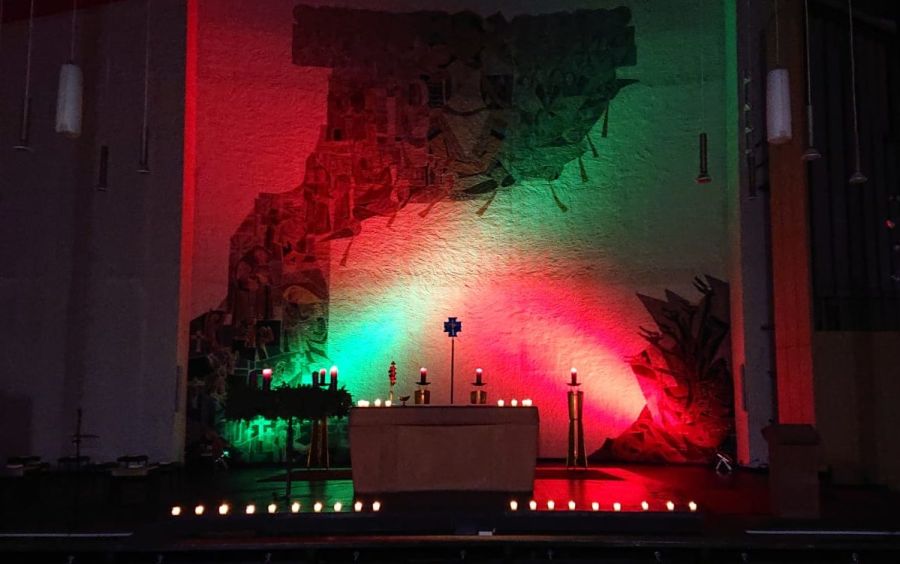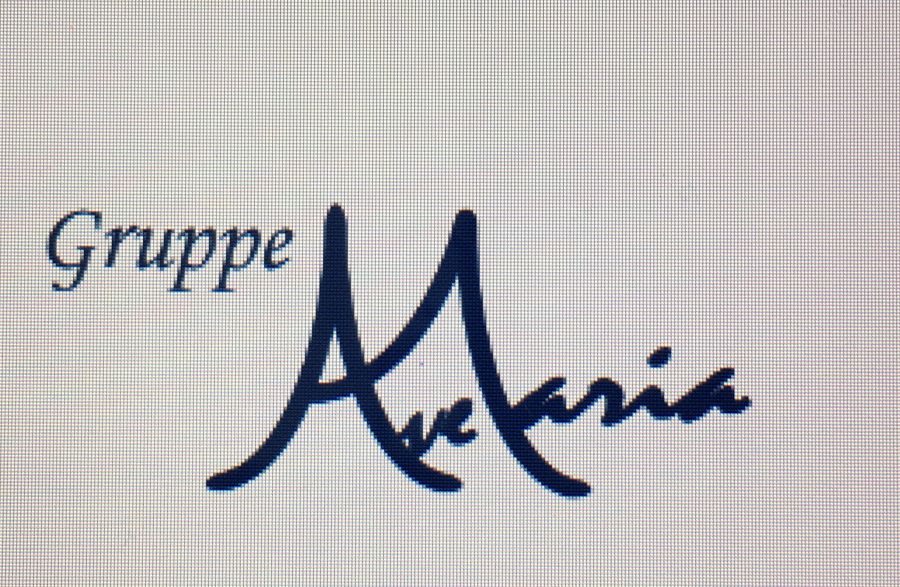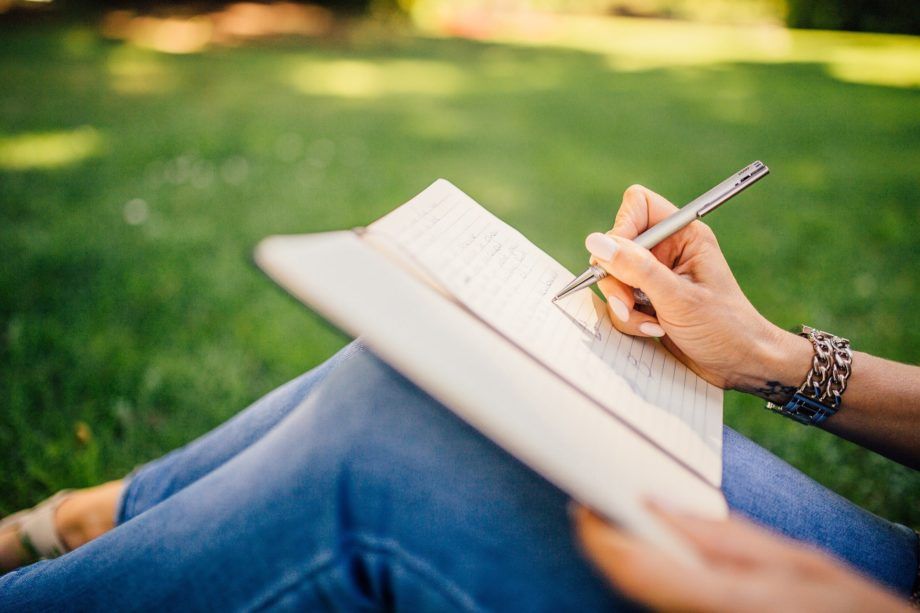-
-
YOU!gendkirche
-
Ave Maria
Spiritualität
Anbetung in der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill
‚Das Gebet ist nichts anderes als Aufmerksamkeit in ihrer reinsten Form‘. (Simone Weil)
Kreuz & Quer
Hier finden Sie die Angebote der Gruppe “Gottesdienst anders gestalten” für das Jahr 2023

YOU!gendkirche
Die YOU!gendkirche ist eine moderne und junge Art von Gottesdienst. Sie findet unter normalen Bedingungen alle 2-3 Monate statt und wird vom YOU!gendkirchen-Team in wöchentlichen Treffen vorbereitet.

Impulse
Auf unserem Youtube Kanal Katholisch an der Dill finden Sie zahlreiche Videoimpulse quer durch das Kirchenjahr.
Ave Maria Gruppe Dillenburg
Eine Gruppe, die über alle Glaubens- und Lebensthemen spricht, sich gerne austauscht und im Gebet einmünden möchte.
Andachtskreis Herborn
Der christliche Glaube wird erfahrbar und lebendig durch vielfältige Frömmigkeits-formen. Der Andachtskreis in Herborn hat das Ziel, diese christliche Gebetsarten zu pflegen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Einige Tage liegt nun schon das Osterfest zurück – Tage, die von den Menschen sehr unterschiedlich erlebt und begangen wurden. Viele hatten schöne Tage zu Hause oder im Urlaub, mit den Kindern, den Enkeln oder mit guten Freunden. Manche haben das Osterfest christlich begangen und des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi gedacht. Vielleicht haben gerade an Ostern auch viele Menschen für den Frieden gebetet und an die Menschen gedacht, die von Tod und Leid geplagt sind und seit Jahren kein friedvolles Osterfest mehr erleben konnten.
Manch einer hat die Tage einsam verbracht und sich nach mehr Nähe und Zuneigung gesehnt. Und manch einer ist schwer krank oder begleitet einen lieben, kranken, nahestehenden Menschen. Für nicht wenige unter uns sind die Fragen von Leid, Tod und Sterben, Freude und Auferstehung in diesen Tagen existentiell.
Wie haben Sie Ostern verbracht?
Egal, ob auf eine der beschriebenen Weisen oder doch ganz anders – immer geht es doch im Letzten um Begegnung, um Gemeinschaft oder Glück und Sinn. Wir alle spüren: Um glücklich, zufrieden oder dankbar zu sein, ist es wichtig, zunächst einmal mit sich selber im Reinen zu sein, sich annehmen und lieben zu können, um dann auch andere annehmen und lieben zu können, so, wie sie sind.
Eine der Ostergeschichten erzählt vom auferstandenen Jesus, der einige seiner Jünger nach Emmaus begleitet. Sie erkennen ihn nicht sofort, zu sehr sind sie gefangen in ihrem eigenen Schmerz und der schrecklichen Erinnerung an die grausame Kreuzigung Jesu. Und Jesus nimmt sich Zeit, den Schmerz zu teilen und zu verstehen, denn das ist wichtig. Die Jünger erkennen ihn erst später: Beim Gewähren von Gastfreundschaft in der plötzlich hereingebrochenen, dunklen Nacht, beim Brechen des Brotes, bei liebevoller Gemeinschaft. Jesus versöhnt, weil er unseren Schmerz, unsere Dunkelheit kennt. Er schenkt auch uns heute, besonders in schweren Momenten, durch versöhnende Liebe die Morgenröte der Auferstehung, neue Hoffnung. Diese Liebe fängt bei mir selber an. Wer in sich Gottes Licht und Liebe fühlen darf, der wird auch für andere zum Licht.
In diesem Sinne frohe, lichtvolle, gesegnete Ostern wünscht Ihr
Christian Fahl, Pfarrer der katholischen Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill

Fastnacht und Aschermittwoch
Der Tor sagt in seinem Herzen: / Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderbt und tun abscheuliches Unrecht, da ist keiner, der Gutes tut. (Ps 53,2) Im Psalm wird die alles überragende Gestalt des Narren gezeichnet, eben jemanden der Gott ablehnt. Aber tun wir dieses, wenn wir in der 5. Jahreszeit die Fastnacht oder den Karneval feiern? Nein! Wir Christen wissen um die Vergänglichkeit des Lebens und darum, dass wir der Erlösung bedürfen. Um uns auf das Erlösungsfest Ostern vorzubereiten haben wir ab Aschermittwoch die 40 Tage des Fastens. Im Alten Testament wird Fasten zum Ausdruck der Trauer, Buße, Intensivierung des Gebetes und Vorbereitung auf besondere religiöse Ereignisse und Feste. Die Fastnacht tritt daher in die Opposition durch fette Speisen, Tänze und Spiele. Das Leben wird gefeiert und man darf ungestraft der Obrigkeit die Meinung sagen. Kirchliche Rituale wurden parodiert und Kinderbischöfe eingesetzt, der Schlüssel der Stadt den Narren übergeben oder die Garden zogen in Umzügen durch die Stadt. Tiermasken verkörpern die Laster oder das Böse. Hier siegt das Leben. Zur Fastnacht gehört aber dann auch der Aschermittwoch und der Karfreitag. Da wir die Erlösung Christi feiern dürfen, sollen und müssen wir uns auch darauf vorbereiten. Nur „sündigen“ geht nicht! Daher ist der „Narr“ nicht der Törichte nach dem Buch der Psalmen, sondern weiß um Gott und bereitet sich ab Aschermittwoch mit dem Gebet und unterstützendem Fasten auf Ostern vor – das große Erlösungswerk Gottes an uns Menschen. Es ist auch die Zeit, in der wir beichten dürfen und unsere Taufgnade zurück erlangen können. Wer seine Sünden bereut, dem wird die Vergebung Gottes zugesagt. Selbsterkenntnis und innere Reife sind Früchte der österlichen Bußzeit. „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ (Francis Bacon) So hat alles seine Zeit im Leben, das Feiern und sich Besinnen. Wir, die wir an Gott glauben, sind die Dankbaren und das feiern wir ausgelassen an diesem Wochenende.
Kaplan Matthias Thiel

Liebe Leserinnen und Leser,
Schon wieder ist das neue Jahr zwei Wochen alt. Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann verfliegen die Jahre anscheinend immer schneller. Die Zeit um Weihnachten und Neujahr fühlt sich schon für viele weit weg an.
Zeit scheint überhaupt erbarmungslos weiter zu laufen ohne große Änderungen – während für die einen nach Urlaub oder den Ferien der Alltag wiederbeginnt, gehen leider in anderen Teilen der Welt Kriege, Elend und Katastrophen weiter wie bisher. Zeit und Welt scheinen unerbittlich zu sein. Und das wiederum macht vielen Angst. Werde auch ich einmal von einer Naturkatastrophe betroffen? Was wird aus mir oder gar aus meinen Kindern? Wie komme ich irgendwie durch?
Bei allen Krisen dieser Welt, bei all dem unendlich vielen, was sich sofort ändern müsste, mag ich selbst aber nicht so recht einstimmen in Resignation und Gejammer – das kann doch nicht im Sinne unseres Schöpfers oder der Schöpfung sein. Können nicht wir selbst die Welt verändern, jede und jeder von uns ein wenig und alle gemeinsam ein großes Stück?
Oft ist es so, dass wir wegen manch Ängsten oder vieler schlechter Nachrichten gar nicht merken, dass wir das Leben nur noch von außen nach innen wahrnehmen und fühlen. Damit machen wir uns aber von unserer Umgebung voll abhängig. Dann wird der Blick nicht nur für die guten Nachrichten in der Welt, sondern auch die guten Eigenschaften, das gute Potential in mir immer kleiner.
Vielleicht könnte ein guter Vorsatz für das jetzt gar nicht mehr so neue Jahr sein, die Welt einmal von innen nach außen wahrzunehmen, mehr in sich hineinzufühlen, in die Stille zu kommen. Das kann neue Perspektiven und einen guten Blick für das Licht, das Gute, die Sehnsucht in mir schenken.
Was aber, wenn in mir nur Leere, Müdigkeit oder Traurigkeit anzutreffen sind? So viel sei verraten: Wer den Zustand, bei sich in der Stille zu bleiben, vielleicht einmal nichts zu denken und ganz in die Ruhe zu kommen, etwas längere Zeit auszuhalten vermag, erlebt eine positive Überraschung.
Von diesem inneren Licht im Herzen wünsche ich uns allen viel Frieden und neue Impulse für das nun begonnene neue Jahr 2024,
Ihr Christian Fahl, Pfarrer der katholischen Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill, Dillenburg

Liebe Leserinnen und Leser,
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende – Zeit für viele von uns, Rückblick zu halten, zuerst einmal ganz privat:
Manch einer wird auf viel Schönes zurückblicken, auf neue Aufbrüche und Begegnungen nach der Pandemie vielleicht, vielleicht gar auf eine Hochzeit oder ein anderes großes Fest. Manch einer mag auf ein Jahr voller Sorgen zurückblicken, auf Krankheit oder gar auf den Tod geliebter Menschen. So ein Jahresrückblick ist einmal eine sehr persönlich und individuell. Und doch merken wir: Mich gibt es nicht nur alleine, das Handeln meiner Mitmenschen hat einen erheblichen Einfluss auf das, was erinnert wird. Wie viel leichter wird das Leben, wenn in guter Weise klar wird: Ich bin nicht alleine, mir wird geholfen, ich werde gesehen.
Ein ehrlicher Rückblick wird aber immer auch die großen Fragen bedenken: Wie geht es weiter mit der Wirtschaft, mit der Umwelt in dieser Zeit großer Umwälzungen? Gelingt es, wenigstens im nächsten Jahr im Nahen Osten, in der Ukraine und in so vielen anderen Teilen der Welt zum Frieden, zu neuen Perspektiven zu kommen – oder versinkt die Welt immer mehr im Chaos? Wie geht es weiter mit der künstlichen Intelligenz, die unser Leben noch nachhaltig verändern wird? Wo kommen die Antworten her auf die vielen, komplexen Fragen in einer Welt, die immer schwerer zu verstehen ist?
Hoffnung und Angst, Freude, aber vielleicht auch Resignation und Rückzug bestimmen je nach eigener Erfahrung dann nicht nur den Rückblick, sondern auch den Ausblick und haben viel damit zu tun, wie wir die kommende Zeit dann tatsächlich erleben und empfinden werden.
Ich möchte uns ein Zitat von Nelson Mandela auf den Weg geben: „Mögen deine Entscheidungen deine Hoffnungen widerspiegeln, nicht deine Ängste.“
Gerade als Christen glauben wir doch, dass Gott in unserem Herzen, in unserer Mitte neu geboren werden möchte, er, der die Menschheit vereint, den Frieden schenkt und den Tod besiegt. Er will mit uns an einer neuen, verständnisvolleren, friedlicheren, gerechteren, würdigeren, nachhaltigeren Welt bauen. Wenn wir ihm das zutrauen, in seine Hand die Zukunft legen und selbst tatkräftig mitschöpfen, mitbauen, dann wird das Jahr 2024 liebevoller, heller, gesegneter. Von diesem Segen Gottes, von diesem inneren Licht, von diesem fröhlichen Herzen wünsche ich uns allen viel Frieden und neue Impulse für das kommende Jahr 2024,
Ihr Christian Fahl, Pfarrer der katholischen Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill, Dillenburg

Gerechtigkeit heute !?
Schwestern und Brüder, das Sonntagsevangelium in der katholischen Kirche ist das berühmte Evangelium von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-16). Und dieses Evangelium passt in besonderer Weise in die jetzige Zeit. In den verschiedenen Weinbaugebieten in Deutschland hat die Weinlese begonnen und wir können frischen Federweisen kaufen. Der Text stellt aber auch eine andere Frage der Gerechtigkeit. Sollen alle den gleichen Lohn erhalten obwohl sie so unterschiedlich viel arbeiten? Mir fällt da spontan ein Satz aus dem zweiten Brief an die Thessalonicher ein, der alle vier Wochen morgens in der Laudes, in der Kurzlesung steht. „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“ (2.Thess 3, 10b) Da werden jetzt einige Paulus sehr gerne recht geben wollen. Anders gelesen heißt es aber auch: Wer arbeitet soll davon leben können! Eine Aussage, die auch jeder von uns teilen kann.
Papst Leo XIII hat in seiner Sozialenzyklika „Rerum novarum“ vom 15. Mai 1891 bereites das Thema eines gerechten Lohnes aufgegriffen, dass bis heute seine Gültigkeit behält. „Privates Eigentum zu besitzen, ist ein dem Menschen von der Natur verliehenes Recht,“ „Die Arbeit hat beim Menschen zwei Merkmale […] dass sie persönlich ist […] weil die Frucht der Arbeit dem Menschen für die Lebenshaltung nötig ist.“ Daraus ergeben sich für den Gerechten Lohn 3 Säulen. Er muss der Arbeit angemessen sein. Er muss die Familie ernähren können. Er muss ein bescheidenes Vermögen ermöglichen. In 132 Jahren hat sich im Prinzip nichts verändert und die Kirche steht nach wie vor hinter diesem Prinzip. Daher ist es gut, dieses allen Menschen immer wieder ins Gedächtnis zu Rufen. Denn wir alle müssen immer wieder an einer Gerechten Welt arbeiten. Ob in Parteien, wie jetzt im Wahlkampf, Gewerkschaften, Verbänden oder Kirchen. Wir müssen für diese Gerechtigkeit kämpfen. Nur Gott ist es, der nicht auf die Leistung schaut, sondern auf den Menschen. Das ist die eigentliche Botschaft des Evangeliums.
Kaplan Matthias Thiel

„Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Matthäus 16, 15)
Diese Frage stellt Jesus seinen Jüngern im Evangelium, das an diesem Sonntag in den katholischen Kirchen gelesen wird. Im Bibeltext scheidet sich an dieser Frage die Spreu vom Weizen. Die Menschen halten Jesus für Elija, für Johannes den Täufer oder für einen der Propheten. Petrus hat aufgrund seiner Erfahrungen mit Jesus da eine andere Sicht: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Und wir? Was würden wir denn sagen, wenn Jesus uns fragen würde, für wen wir ihn halten? Wahrscheinlich würden wir mit Petrus sagen: Ja, du Jesus bist Sohn des lebendigen Gottes, aber was bedeutet das ganz persönlich für mich? Wenn er für mich Sohn Gottes ist, kann er dann auch Mensch sein? Mensch wie du und ich, mit Freude und Leid, mit Hoffnungen und Enttäuschungen, mit Gelingen und Scheitern? Indem Gott in Jesus Mensch geworden ist, macht er sich angreifbar, ist er verletzlich. Aber er schenkt uns dadurch auch eine Nähe, die uns zu vielen Zeiten des Lebens unendlich gut tut. Seine Liebe wird fassbar und sichtbar, unsere Beziehung zu ihm bekommt eine neue Lebendigkeit. Aber er ist eben auch und in erster Linie Gott, immer wieder haben die Menschen das in seinem Wirken erfahren. Und auch wir spüren in der Begegnung mit ihm Heil, Kraft und Berührung, wie Menschen sie nicht geben können.
Für wen halte ich also Jesus? Wir sind eingeladen, diese Frage in uns wirken zu lassen, ihm immer wieder zu begegnen – im Alltag und auch in Momenten, die wir extra für diese Begegnung schaffen. Ich bin sicher, er wird sich uns dann zeigen, als liebender Mensch, mit dem wir lachen und weinen können. Als Gott, der uns trägt und hält und in dem wir Hoffnung auf Leben und Lebendigkeit haben dürfen, hier auf dieser Erde und weit über den Tod hinaus.
Stefanie Feick

Du trägst eine heilende Kraft in dir, wie die Heilkräuter
Kräuter sind Symbol für Schönheit und Kraft der Schöpfung. Kräuter können heilen und Geschmack geben, angenehmen Duft verbreiten. Viele weise Frauen – unter anderem Hildegard von Bingen – wussten um die Heilkraft der Kräuter.
Es war ein vorchristlicher Brauch – bei Kelten und Germanen – Gott zu danken für
die Kräuter und durch Gebet Kraft zuzusprechen. Dieser Brauch wurde in das Christentum übernommen, zur Kräuterweihe.
Diese Feier ist verbunden mit dem Hochfest Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August. Am Vortag des Festes werden die Heilkräuter gesammelt und zu Kräutersträussen gebunden. Es gibt keine festen Regeln, welche Kräuter und wie viele. Man arbeitet mit dem, was man eben gesammelt hat. Wichtige Bestandteil sind Königskerze, Johanniskraut, Salbei, Kamille, Frauenmantel, Lavendel, Petersilie, Rosmarin und weitere, dazu kommen noch die Sommerblumen und Getreide. Geweihte Kräutersträuße werden an die oberste Stelle des Hauses oder vor die Tür gehängt. Er soll vor Krankheiten und Unwetter schützen.
Was haben Kräuter und die Kräuterweihe mit Maria zu tun? Eine treffende Formulierung fand ich bei Andrea Schwarz in „Eigentlich ist Maria ganz anders“ auf S. 97: “Maria ist, ähnlich wie die Kräuter, ein Duft, ein Geschmack, ist Farbe, Geschenk Gottes, ist ein Gedicht, eine Melodie. Sie ist eine Frau, die die Kraft Gottes in sich trägt, eine Kraft, die heil machen kann“. So wie die Heilskraft und der Duft der Kräuter allen zugänglich ist, gilt allen das Heil Gottes. Seine Heilskraft trägst du in dir. Sie will heute durch dich in der Welt sein, um heilend zu wirken. Bist du bereit?
Am 19./20. August werden in der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill die mitgebrachten Kräutersträuße in den Gottesdiensten gesegnet.
Pater Paulose Chatheli

Fronleichnam für Alle
In dieser Woche wird auch in Zeitungen oft erklärt, warum Katholiken Fronleichnam feiern und warum damit so “merkwürdige” Bräuche einhergehen, wenn mit Prozessionen und Gesang durch die Städte und Dörfer gezogen und Jesus hoch erhoben durch die Straßen getragen wird. Doch es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass wir Menschen gerne zeigen, was uns wichtig ist: Hochzeitsfotos erzählen Bände von der Bedeutung der Liebe, Fanschals von Vereinen symbolisieren die Leidenschaft für ein gemeinsames Ziel, und in den sozialen Netzwerken teilen wir unser Leben mit anderen.
Fronleichnam ist quasi ein Statement, dass Jesus an der ersten Stelle steht (das bedeutet der Name des Festes übrigens, „frone licham“ bedeutet, also „alles, was den Leib des Herren betrifft“) – und dass für ihn überall im Leben Platz ist, nicht nur in der Kirche oder den Gemeindezentren. Es erinnert uns daran, dass es Dinge gibt, die uns heilig sind, und dass wir gemeinsam feiern können, was uns wichtig ist. Das ist für die Christen natürlich immer zuerst Christus selbst, aber auch alles andere, was uns im Leben Mut und Lebensfreude gibt, verdient es, gefeiert zu werden, weil sie uns eine Ahnung geben, dass wir zur Freude berufen sind.
Es mag mittlerweile oft ein Trend sein, alle persönlichen Emotionen und Anschauungen in das Private zu verbannen. Aber selbst wenn es Unterschiede in den Überzeugungen gibt, ist es wichtig, diesen großen emotionalen Schatz, der bei jedem und jeder ganz unterschiedlich sein kann, nicht zu verstecken. Alle Menschen sammeln Erfahrungen, entwickeln Meinungen und finden Überzeugungen – und die Freude darüber zu teilen ist trotz aller Gegensätze ein guter Weg zu einem Miteinander.
Lasst uns also nicht vergessen, was uns „heilig“ ist, so unterschiedlich das auch sein mag. Denn im Feiern und Zeigen dessen, was uns wichtig ist, finden wir Inspiration und Gemeinschaft für den Glauben und fürs Leben
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnetes und erholsames Fronleichnamswochenende

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh.3,16)
Der Tod ist etwas Alltägliches in unserem Leben geworden, solange er uns nicht unmittelbar selbst betrifft.
Der Tod als Hiobsbotschaft gehört zum „journalistischen Brot“, denn täglich hören wir vom Krieg in der Ukraine oder anderswo, von Familien, die den Tod eines Angehörigen zu beklagen haben, von Gewalt an Frauen und Kindern, von Todesfällen auf unseren Straßen oder von Naturkatastrophen, denen unschuldige Menschen zum Opfer fallen.
Bei vielen dieser Nachrichten sind wir momentan geschockt, denn uns ist klar, dass mit dem Tod viele Pläne und Hoffnungen begraben wurden. All zu schnell gehen wir zur Tagesordnung über und somit wird der Tod zum Alltäglichen.
Heute am Karfreitag machen wir uns Gedanken um den Tod eines Menschen, der vor über 2000 Jahren gestorben ist. Ist es nicht seltsam, dass wir noch heute seine Lebensgeschichte und besonders seine letzten Worte kennen. Viele Menschen sind damals derart am Kreuz gestorben. Aber die Erinnerung an seinen Tod ist lebendig geblieben und warum ist sein Leiden und Sterben für uns so wichtig? Hier starb jemand, der unschuldig war und er starb für uns alle. Aus Solidarität geht er diesen Weg mit uns und für uns. Wir glauben und vertrauen darauf, dass durch den Tod Jesu auch unsere Schuld am Kreuz mitgestorben ist. Sein Tod war etwas Außergewöhnliches – denn er endet nicht im Grab, sondern Jesus ist auferstanden.
Jesus ist am Kreuz gestorben, damit auch wir einst getrost sterben können. Wir fallen nicht ins „Leere“, weil wir „in Gott“ ein Leben in Fülle finden.
Pater Joseph Mathew


Gott lieben…?
Wenn ich an die biblische Gestalt des Petrus denke, dann beeindruckt mich vor allem seine Liebe zu Jesus. Denn dieser gestandene Mann agiert voller Leidenschaft, wenn er von etwas überzeugt ist, aber liegt mit seiner Einschätzung nicht immer richtig. Und eben noch hat er Jesus mit dem Schwert verteidigt, da leugnet er wenig später sogar, ihn zu kennen. Was er bitterlich bereut, denn seine Liebe zu Jesus ist aufrichtig (vgl. Joh 15-19).
Und ich – kann auch ich aus ganzem Herzen sagen, dass ich Jesus liebe? Eine Lehrgeschichte aus dem Judentum führt vor Augen, dass es mit dem Festhalten an der Liebe zu Gott in unserem Alltagsleben gar nicht so einfach ist:
Ein junger Mann kommt zum Rabbi und sagt: „Ich möchte gerne dein Schüler werden.“ Da fragt ihn der Rabbi: „Liebst du Gott?“ Der junge Mann sagt nachdenklich: „Eigentlich, lieben, das kann ich nicht behaupten.“ Der Rabbi sagt freundlich: „Nun gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du Sehnsucht danach, ihn zu lieben?“ „Ja, manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, ihn zu lieben sehr deutlich, aber oft geht mir die Sehnsucht im Alltag unter.“ Da zögert der Rabbi und sagt dann: „Hast du dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben?“ Da strahlt der junge Mann und sagt: „Genau das habe ich. Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben.“ Der Rabbi entgegnet: „Das genügt. Du bist auf dem Weg.“
Man hätte vielleicht erwartet, dass der junge Mann voller Eifer geantwortet hätte: „Ja, ich lieben Gott!“ Aber er hat seinen Glauben sehr ernst genommen und war ehrlich, auch sich selbst gegenüber. Als gläubige Menschen möchten wir Gott aus ganzem Herzen lieben. Aber gelingt uns das wirklich – jede Stunde, jeden Tag, ein Leben lang? Uns bleibt die Sehnsucht danach, Gott zu lieben, und manchmal auch nur die Sehnsucht nach der Sehnsucht. Und der Rabbi sagt: “Das genügt. Du bist auf dem Weg.“
Klinikseelsorgerin Maike Bittmann

Mit Gottes Segen
„Segen bringen Segen sein“- dies ist ein Slogan, der jedes Jahr die Sternsingeraktion rund um den 6. Januar begleitet. Vor einer Woche waren auch hier in der Gegend viele Kinder und Erwachsene unterwegs, die den Segen Gottes zu vielen Menschen nach Hause gebracht haben. Dazu gehört der Segen an der Haustüre: 20 C+M+B 23 – Christus segne dieses Haus im kommenden Jahr. Dies bringt etwas ganz grundlegendes in meinem Leben zum Ausdruck: für mich bedeutet es, mein Lebenshaus unter den Segen Gottes zu stellen, ich lebe vom und mit dem Segen Gottes.
Nicht das dadurch mein Leben nur rosarot ist. Nein, das ist es nicht. Aber ich weiß mich von Gott angenommen, auch dann wenn es mir selbst vielleicht gerade schwer fällt. Ich weiß mich von Gott auf all meinen Wegen begleitet, auch dann, wenn ich den genauen Weg nicht weiß. Klar, ich muss auch meinen Teil tun, aber ich darf dabei immer auch der Zuwendung Gottes vertrauen.
Wenn ich zulasse, dass mich Gottes Liebe in meiner Mitte berührt, verändert mich das. Es verändert mich und meine Haltung, mit der ich unterwegs bin. Es verändert so auch meinen Blick auf die Welt und wie ich dem und der Nächsten begegne.
Was uns im neuen Jahr erwartet wissen wir nicht. Es wird mehr sein als das, was von uns im neuen Kalender schon eingetragen wurde. Ganz gleich was geschieht, wir dürfen vertrauen, dass wir es meistern werden mit Gottes Segen.
In diesem Sinne wünsche ich ein gesegnetes 2023
Marion Schroeder
Gemeindereferentin in der katholischen Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill

Liebe Leserinnen und Leser,
Es ist Advent – eine runde Sache! Wenn die vierte Kerze brennt, schließt sich der Kreis am Kranz buchstäblich. Wenn hoffentlich alle Geschenke besorgt sind, kann Weihnachten kommen. Wer über die Weihnachtsmärkte geht oder sich in unseren Dörfern und Städten in die Kaufhäuser stürzt, könnte schnell meinen, alles sei gut wie immer. Doch ist das so?
Nicht, wenn wir hinter die Kulissen schauen. Dann spüren wir viel vom Dunkel dieser Welt!
Wie schon im letzten Jahrzehnt sind auch in diesen Wochen und Monaten sehr viele Menschen auf der Flucht, weil Kriege, Dürren und Gewalt oft schon ein bloßes Überleben unmöglich machen.1500 km östlich von uns tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg, der Tod und Leid in einem Ausmaß über Millionen von Menschen bringt, das im letzten Advent noch kaum einer für möglich gehalten hätte.
Macht in solch einer Welt Advent überhaupt noch Sinn?
Gibt es realistische Hoffnung in dieser leidenden Welt oder ist unser Advent nur ein fauler Zauber, ein falsches Licht zwecks Ablenkung und Konsum?
Ich meine: Es gibt Hoffnung! So möchte ich zwei kleine Hoffnungszeichen, die mir in den letzten Tagen geschenkt wurden, mit Ihnen teilen.
Vor wenigen Tagen las ich im Internet Kommentare zu einer bekannten Aufführung des Musikstückes „The Rose“. Darin berichtete ein Mann vom tragischen Tod seiner jungen Ehefrau kurz nach der Geburt des Kindes. In dieser Zeit der Trauer habe er dann im Radio dieses Lied gehört – und spürte einen tiefen Trost. Da musste etwas sein, eine Hoffnung, ein Licht, das selbst stärker war als dieser schreckliche und viel zu frühe Tod.
Und dann hörte ich wenige Tage später im Radio eine Hörerin, die sich im Studio zum Thema Hoffnung zu Wort meldete. Sie berichtete von Schicksalsschlägen in ihrem Leben, unter anderem von ihrem Ehemann, der viele Monate im weit entfernten Krankenhaus lag, was nur schwer zu erreichen war. Doch dann sagte sie etwas sehr tröstliches: „Hätte ich denn etwa negativ denken und ihm die Hoffnung nehmen sollen? Ich habe aus dem Glauben mein ganzes Leben Hoffnung und Zuversicht schöpfen dürfen und mich gerade in schweren Zeiten getragen gefühlt.“
Wow – was für eine Stärke!
Und die wünsche ich auch uns. Wir sollten alle zu adventlichen Menschen werden. Wenn wir Licht an unsere dunklen Orte bringen, dann kann es wahrhaft Weihnachten werden.
In diesem Sinne wünscht Ihnen allen einen gesegneten vierten Advent
Ihr
Christian Fahl, katholischer Pfarrer der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill, Dillenburg

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit Wochen finden sich Adventskalender in allen Formen und Variationen in den Geschäften. Dabei
gibt es seit einigen Jahren auch für Erwachsene eine riesige Auswahl. Die Produktpalette und die
Inhalte der Kalender mögen einen manchmal verwundern und lassen einen vielleicht staunen. Und
trotzdem können Adventskalender genau darauf hinweisen, was der Advent eigentlich möchte. Es
geht dabei aber weniger um die Füllung, als vielmehr um die Tätigkeit, die man ausführen muss, um
an diese zu gelangen: Das Türchenöffnen!
Advent. Der lateinische Begriff heißt auf Deutsch: Ankunft. Für Christ:innen ist der Advent die Zeit
der Erwartung, die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christi, dessen “Geburtstag” wir in der
Weihnachtsnacht feiern.
Wobei es ja nicht nur um die Erinnerung an ein geschichtliches Ereignis geht. Der Kirchenlehrer
Bernhard von Clairvaux hat den Ausdruck der „Gottesgeburt im Menschen“ geprägt. Gottes Geist
und seine Kraft, er und seine frohmachende Botschaft möchten bei jedem und jeder uns ankommen und in uns geboren werden! Darauf sollen wir uns im Advent vorbereiten.
Und – logisch – damit jemand oder etwas bei uns ankommen kann, müssen wir ihm oder ihr erstmal
die Türe öffnen. “Macht hoch die Tür, die Tor macht weit”, heißt es da ja auch ganz passend in einem
unserer bekanntesten Adventslieder. Und ich vermute, Gott kommt’s da weniger auf
„herausgeputzte“ und liebevoll dekorierte „Innenräume“ an. Er kommt auch in mein ganz
persönliches Chaos, wo so vieles bruchstückhaft oder unerledigt ist, wo Zweifel herrschen und ich
manchmal ganz mutlos bin. Unsere Türen für Gott zu öffnen geschieht aber auch dann, wenn wir
unseren Mitmenschen offen und freundlich begegnen und uns unterstützen, wie es uns möglich ist.
Ich wünsche uns, dass wir im Advent das „Herzenstürchen öffnen“ üben! Und jeden Tag eine kleine freudige Überraschung – im Adventskalender und auch im ganz normalen Alltag.
Eine gesegnete Adventszeit,
Bettina Tönnesen-Hoffmann

Sehnsucht nach einem liebenden Blick.
Diese Sehnsucht steckt in jedem Menschen. Wenn ein liebender Blick jemanden trifft, spürt er Wohlwollen und Annahme. Er/ sie fühlt sich angenommen und geborgen.
Wenn einer, der durch seinen liebenden Blick, dir Geborgenheit geschenkt hat, bei dir zu Gast sein will, wirst du ihn mit großer Freude aufnehmen. Seine Nähe und Gegenwart können dein ganzes Leben verändern. Von so einer Begegnung lesen wir am 30.10. in den katholischen Gottesdiensten. Es ist die Geschichte von Zachäus, nach Lukas 19, 1-10.
Zachäus hörte von Jesus. Er wollte ihn gerne sehen. Er wartete auf ihn und weil er klein war, stieg er auf einen Baum. Als Jesus vorbeikam sprach er mit liebendem Blick Zachäus an und sagt: „Komm herunter, heute will ich in deinem Haus zu Gast sein“. Zachäus freute sich sehr und er fühlte sich angenommen. Jesu Gegenwart und seine Nähe veränderten sein ganzes Leben. Vom Betrüger wurde er zu einem ehrlichen, freigiebigen Menschen. Er konnte offen über sein Versagen sprechen und seine Fehler bekennen. Und er wollte alles tun, um sich zu ändern. Und tatsächlich machte er alles, um die getanen Ungerechtigkeiten wieder gut zu machen.
Zachäus hatte die Menschen über Jesus reden hören. Und er wollte ihn unbedingt sehen. Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Diese Begegnung hat sein ganzes Leben verändert. Er gesteht seine Sünden. Er tut, was er kann, um alles wieder gut zu machen. Versöhnung und Heil ist ihm geschenkt worden.
Ein liebender Blick, ein authentisches Leben berührt die Herzen. Diese Begegnung verändert das Leben zum Guten. Es macht Mut Fehler einzugestehen.
Ich muss meine Grenzen und mein Fehlverhalten erkennen und bekennen und alles tun, was ich kann, um Versöhnung und Frieden zu stiften. Das ist der Weg zum friedlichen Miteinander im Kleinen und im Großen.
P. Paulose Chatheli

„Ein Segen sollst du sein…“
„Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land,…in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich segnen. Ein Segen sollst du sein.“
Diese Worte aus dem Buch Genesis sind uns sehr vertraut. Mich begleiten sie schon lange Zeit durch mein Leben und sind prägend für meinen Glauben.
Gesegnet sein, Segen haben, zum Segen werden, ein Segen sein: Das sind Begriffe, die sind mir unendlich wichtig. Gesegnet zu sein, das heißt, beschützt zu sein, das heißt reich beschenkt zu sein, Fülle zu erleben. Wie sehr ich gesegnet bin, erlebe ich, wenn Menschen mir ihre Liebe schenken und für mich da sind, aber auch, wenn ich die Schönheit der Natur erleben darf oder mir das gelingt, was ich mir vorgenommen habe. Und ebenso darf ich erleben, dass andere mir sagen oder zeigen: Du bist ein Segen für mich, es ist ein Segen, dass es dich gibt. Und so geht es Ihnen sicher auch, wir alle dürfen immer wieder erleben, wie reich gesegnet wir sind – in den guten, aber auch in den schweren Momenten des Lebens.
Ich will dich segnen, ein Segen sollst du sein – Im Bibelwort ist das Gottes Versprechen und Auftrag an Abraham. Er soll sich auf den Weg machen, in ein neues Land gehen. Es ist kein leichter Weg für Abraham. Doch er vertraut auf Gott, er macht sich auf den Weg – vielleicht weil er spürt: Segen kann nur dann lebendig und erfahrbar sein, wenn ich auf Gott höre, Aufbruch wage und mich auf seinen Plan einlasse. Und dazu sind wir alle eingeladen. Dass wir offene Herzen haben, Gottes Wort hören und seinen Weg gehen können, auch wenn es uns schwer fällt. Weil wir uns gesegnet wissen, und weil wir als Christen Segen in die Welt bringen dürfen. Mögen wir an jedem Tag Gottes reichen Segen erfahren. Mögen wir zum Segen werden in vielen kleinen und großen Gesten. Dazu gebe Gott uns seine Kraft und seinen Segen.
Stefanie Feick, Gemeindereferentin in der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill

„Was muss ich tun, um das Leben bei Gott zu gewinnen?“, so fragte ich meine Schüler. Die
Antworten waren vielfältig: Ich soll hilfsbereit sein, mich um den anderen kümmern, nicht
böse sein, ich soll mich nicht schlagen – Das waren die spontanen Antworten der jungen
Menschen.
Das Neue Testament drückt die Antwort auf diese Frage ganz einfach aus: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all
deinen Gedanken und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.
Das wunderbare Gleichnis vom Barmherzigen Samariter gibt uns Antwort auf die Frage, was
Gottes- und Nächstenliebe bedeuten.
Behandle deine Mitmenschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest –
unabhängig von Hautfarbe, Gesundheit, sozialem Status, ob er mir ein Freund oder Feind ist
oder seiner politischen Gesinnung. Jeder, der mir begegnet, ist mein Nächster. Darin liegt die
Größe meines Handelns: Dass ich einem Menschen die Hilfe und Unterstützung zukommen
lasse, die er gerade und in diesem Moment braucht.
Aber wo bleibt die Gottesliebe – so fragen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser. Diese Frage
hat Jesus ganz einfach beantwortet: Alles, was ihr einem Menschen egal welcher Hautfarbe,
ob gesund oder krank, unabhängig von sozialem Status, ob Freund oder Feind unabhängig
von seiner politischen Gesinnung, Gutes tut, das tut ihr auch für mich. Gottes- und
Nächstenliebe sind nicht zu trennen. Wer Gott liebt, wird auch seinen Nächsten lieben. Und
wer seinem Nächsten Gutes tut, der tut dies, bewusst oder unbewusst, auch für Gott.
„So einfach soll das sein?“, fragen Sie sich vielleicht.
Ich denke nicht, dass es einfach ist, jeden Menschen einfach als Mensch anzunehmen und
ihm ohne Vorbehalte zu begegnen.
Vielleicht liegt gerade darin die größte Herausforderung für das Leben mit und bei Gott, in
jedem Menschen Gott zu erkennen und ihm ein „Nächster“ zu sein.
Maria Theresia Becker, Bezirksreferentin in Lahn-Dill-Eder

„In den kleinsten Dingen ist Gott am größten.“
An Fronleichnam (seit 1264) – dem Fest vom lebendigen Leib des Herrn – wird ein kleines Stück Brot
verehrt. Durch die Einsetzung der Eucharistie, beziehungsweise des Abendmahls, wollte Jesus immer
bei den Menschen sein – im kleinen Stück vom Brot. Alle, die an die Gegenwart des Herrn Jesus im
Zeichen des Brotes glauben, dürfen ihn in sich aufnehmen. Das gewandelte Brot in der
Eucharistiefeier ist Mittel zur Stärkung der Gläubigen. Da schenkt sich Jesus selbst.
Die liturgischen Texte des Tages heben die Einsetzung des Abendmahles heraus. Der Ruf vor dem
Evangelium lautet: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst,
wird in Ewigkeit leben.“
Besonderheit des Fronleichnamstages ist eine eucharistische Prozession (seit über 750 Jahren). Die
Gemeinde zieht befreit durch Christus im Vertrauen auf Gottesführung dem Land der Verheißung
entgegen.
Wir verehren den Gott mit uns –Immanuel–, der sich das lebendige Brot genannt hat und sich selbst
als wahre Speise gegeben hat und gibt.
Durch die Fronleichnamsprozession zeigen wir das Gute und Wertvollste der Welt. Dabei ehren wir
Christus Jesus als Herrn der Schöpfung. Mit vielen Blumen und schönen Blumenteppichen verehren
wir ihn an diesem Tag. Wir ehren ihn wirklich, denn das Fest unserer Gemeinschaft stärkt zwischen
uns und Gott und untereinander; wenn alle, die sich auf Christus Jesus durch das Essen dieses Brotes
verpflichtet haben, lebendiger „Christus“ werden. Lebendiger Christus können wir werden, wenn wir
in den kleinsten Dingen des Alltags dem Lebensbeispiel des Guten Hirten Jesus folgen. Denn „In den
kleinsten Dingen ist Gott am größten.“ (Franz von Assisi)
Pater Paulose Chatheli, kath. Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill

„Lebbe geht weider“
Dieser Ausspruch eines gut bekannten Fußballtrainers hat doch eine gewisse Wahrheit. Das sehen wir jedes Jahr im Frühling aufs Neue. Das Grün wird immer satter, es blüht an allen Stellen, die Vögel zwitschern und bauen ihre Nester. Eine wiederkehrende Erfahrung des Menschen.
Doch irgendwie ist alles anders. Jesus ist gestorben. Plötzlich ist er auferstanden von den Toten. Das ist was keiner denken konnte obwohl er es angekündigt hat. Er erscheint seinen Jüngern und auch anderen Zeugen. Und jetzt? Und was machen die Jünger? Sie schließen sich ein und beten. Sie gehen erstmal nicht raus. Blockiert, nichts ist so wie früher, kein Lebensmut und keine Perspektive!?
Und dann blicke ich wieder auf die Straße. Die Leute sitzen draußen, trinken ihren Kaffee, unterhalten sich. So als ob alles ganz normal ist. Kein Krieg vor der Haustür, kein Corona, keine Sorgen und Nöte. Das Leben geht einfach weiter!
Es ist diese Botschaft von Ostern. Das Leben hat den Tod besiegt. Wir können anders hoffen und das Leben genießen. Das feiern wir als Kirche 50 Tage lang bis Pfingsten. Dann gehen die Jünger hinaus in die Welt.
Als Katholische Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill machen wir das auch am 08. Mai. Es ist der „erste Namenstag“ der neuen Pfarrei, den wir feiern dürfen. Das Patrozinium, in unserem Fall genauer das Titularfest, hat den Guten Hirten als Idee im Hintergrund. Die Pfarrei möchte für alle Menschen da sein. Es geht um einen fairen und solidarischen Umgang miteinander. Christus als Vorbild für das Handeln der Pfarrei. Er nimmt sich Zeit und schenkt Nähe, geht dem Verlorenen nach und lehrt, dass die ganze Schöpfung von Gott gewollt und verbunden ist.
Ja das Leben geht doch immer weiter. Ein großer Kreislauf mit Freude und Schmerzen, mit Sorgen und Befreiung – Das Leben! Als Christ lebt es sich halt manchmal durch die „Andere Hoffnung“ leichter, befreiter. Und öfter mal mit einem Grund zum Feiern.
Kaplan Matthias Thiel, Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill

Liebe Leserinnen und Leser
Im Dezember erhielt ich ein nettes Geschenk von einem freikirchlichen Mitstreiter aus dem
Hessentagteam der Kirchen: Ein aus Stahl geschnittenes Wort. Hoffnung. Ich fand es echt nett und klebte es neben meinen Monitor im Büro. Seitdem ist ein Vierteljahr vergangen mit Ereignissen, die meine Vorstellungskraft sprengen. Wenn ich an die heißen Monate denke und was sie, gepaart mit dem Krieg in der „Kornkammer der Erde“, für die Menschen in den ärmeren Ländern auf diesem Planeten bedeuten werden, dann wird mir Angst und Bange. Die Welt gerät an so vielen Stellen aus den Fugen. Und wieder fällt mein Blick auf mein stählernes Weihnachtsgeschenk. Hoffnung. Ich stelle fest, es ist mehr, als einfach nur „nett“. Es bedeutet mir mehr und ich bin froh, dass ich es habe. Immer im Blick, wenn ich etwas am PC mache. Denn meine Hoffnung steht aktuell unter
Dauerbeschuss. Sie ist nicht immer so makellos glänzend und so robust, wie dieses kleine Geschenk
in meinem Büro. Sie lässt Federn, sie wird gedämpft, wenn ich die Bilder der Zerstörung oder die Zahl der täglichen Coronatoten sehe. Hoffnung – wird mir bewusst, ist kein Selbstläufer. Ein kurzer Blick in die Bibel reicht, mir zu sagen, dass das aber in Ordnung ist. Selbst starker Glaube erfährt Rückschläge. Angst lähmt. Was also kann man tun, wenn die Hoffnung bröckelt?
Mir hilft, zunächst zu akzeptieren, wie die Situation derzeit ist. Alles, was negativ belastet, muss raus.
Hilfreich kann sein, mit jemandem zu reden, oder den Frust einfach aufzuschreiben. Wichtig sind
auch die schönen Dinge, d.h. sich selbst kleine Glücksmomente zu schenken. Was macht mir Freude?
Umgeben Sie sich mit positiven Menschen, die Ihnen Kraft schenken und Sie ermutigen. Vielleicht
erinnern Sie sich auch an schon gemeisterte Herausforderungen. Wo ist Ihnen etwas gelungen? Und wo können Sie handeln? Vielleicht etwas spenden? Sich ehrenamtlich beteiligen? Egal was.
Geben wir die Hoffnung nicht auf. Manchmal braucht sie etwas Pflege.
Mit besten Wünschen
Michael Wieczorek

Liebe Leserinnen und Leser,
Ist alles verloren? Wenn ich an Karfreitag denke, dann scheint es so. Nichts geht mehr. Christen aller Welt halten inne, gedenken des Todes Jesu am Kreuz. Keine Hoffnung mehr? Tatsächlich: Kein Engel kommt, kein Wunder geschieht. Es ist wie immer. Die Starken, die Brutalen gewinnen. Auf Angst und Verrat folgen Folter, Verurteilung, Schmerz und Tod. Und am Ende noch das grausame Bild von Maria, der Mutter Jesu, die ihren toten Sohn vom Kreuz abnehmen und begraben muss. Auch das noch – zum Schmerz Jesu tritt noch der Schmerz einer Mutter hinzu, die ihren geliebten Sohn sterben sieht und ihn nun auch noch begraben muss. Aus. Vorbei!
Es scheint wie immer, vielleicht sogar ganz besonders wie in diesen Tagen. Denn auch heute stoppt niemand den brutalen Krieg in der Ukraine. Vermutlich zehntausende Menschen sind schon verletzt, geflohen, verschollen, verstorben – und das Leiden wird täglich mehr.
Kann man da überhaupt noch hinschauen? Und was ist überhaupt mit uns, wie soll das hier noch weitergehen? Ist es nicht naiv, nach den Katastrophen der Pandemie, des Klimawandels und des Krieges überhaupt noch an eine gute Zukunft zu glauben?
Karfreitag – und ebenso der Karsamstag – tun sich schwer mit allzu schnellen Antworten. Diese Tage zwingen uns vielmehr, einmal innezuhalten und zu verweilen – bei Jesus am Kreuz, bei seiner im wahrsten Sinn des Wortes tottraurigen Mutter ebenso wie bei den Opfern brutaler Gewalt der Gegenwart.
Und doch: Wenn wir uns wirklich mal Zeit fürs Innehalten nehmen, spüren wir vielleicht etwas durchaus Seltenes und Besonderes: Wie wichtig diese Zeit bist – auch und gerade für die Trauernden, die Leidenden, die Opfer unserer Zeit. Die Stille solch einer Zeit ist kaum auszuhalten, wir sind das ohnehin kaum noch gewöhnt. Stille, Präsenz, Gegenwärtigkeit – wirken heilsam – auch für unsere eigenen Wunden. Im Hinschauen, Zulassen, öffnen der Wunden geschieht Annahme – und es beginnt ein Weg der Erlösung.
In diesem Sinne wünscht Ihnen allen einen stillen, heilsamen Karfreitag
Ihr Christian Fahl